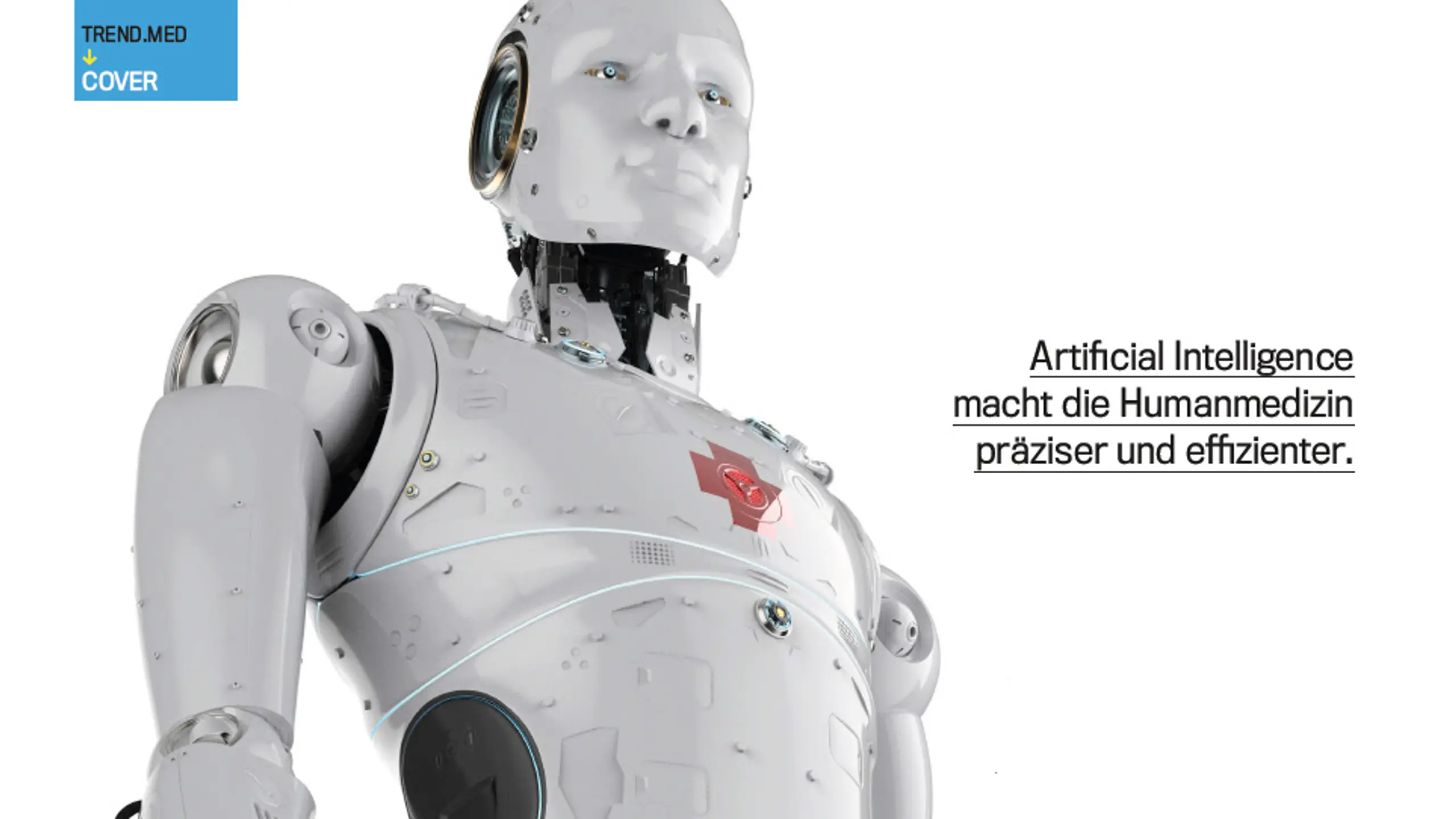
Artificial Intelligence macht die Humanmedizin präziser und effizienter. Auch der Beruf des Arztes verändert sich rasant, denn bei der Diagnose von bestimmten Krankheiten ist KÜNSTLICHE INTELLIGENZ schon heute erfolgreicher als herkömmliche Methoden. Wo KI zum Einsatz kommt und woran geforscht wird.
Algorithmen und künstliche neuronale Netzwerke, die bei der Früherkennung von verschiedensten Krebsarten helfen, Roboter und Hightech-Geräte, die im Operationssaal (OP) assistieren, Netzhautscans, über die Ärzte ins Körperinnere blicken können und „Dr. ChatGPT“, der Behandlungspläne vorschlägt – was einst utopisch klang, ist mittlerweile fixer Bestandteil des medizinischen Alltags. Künstliche Intelligenz revolutioniert die Medizin tiefgreifend und immer rasanter. Während Radiologie und Bildgebung zu den ersten Disziplinen gehörten, in denen KI eingesetzt wurde, um Ärzte bei ihrer Arbeit zu unterstützen, wird maschinelles Lernen mittlerweile auch etwa in der Pathologie, Kardiologie, Dermatologie, Ophthalmologie, Neurochirurgie und Onkologie erfolgreich angewandt.
RASCHERE ENTSCHEIDUNGEN IM OP.
An der Universitätsklinik für Neurochirurgie der MedUni Wien und am AKH Wien setzt man KI seit Kurzem erstmals in Europa sogar direkt im OP ein. Mit Hilfe der primär in den USA entwickelten laserbasierten „Stimulierten Raman Histologie“, kurz SRH, können Neurochirurgen während einer laufenden Gehirntumor-Operation direkt im OP einen digitalen Gewebeschnitt erstellen.
Georg Widhalm, Neurochirurg der MedUni Wien, schildert: „Dabei platzieren wir frische, etwa reiskorngroße Gewebeproben auf einen Objektträger. Diese analysieren wir direkt im OP mit einem hoch spezialisierten Gerät.“ Dadurch können die Neurochirurgen innerhalb von nur drei Minuten ein hochauflösendes, digitales Bild vom Gewebe erstellen, das Neuropathologen anschließend sofort virtuell aufrufen und damit rasch befunden können – ein Vorgang, der ohne die neue Technologie wesentlich länger dauern würde. Denn im internationalen Durchschnitt benötigen der Transport des Gewebes zur Neuropathologie, die manuelle Anfertigung des Gewebeschnitts und deren Analyse rund 30 Minuten.
Das Gerät, das die Neurochirurgen verwenden, hat von über zwei Millionen Bildanalysen spezifische histologische Eigenschaften gelernt und kann bestimmte Tumormerkmale mittels zusätzlicher KI-Technik mit hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen. Widhalm betont: „Die neue SRH-Technik ermöglicht eine raschere und bessere Entscheidung über die optimale chirurgische Strategie im OP. Wenn die KI diagnostisches Gewebe detektiert hat, können wir etwa belastende Nadelbiopsien rascher beenden. Auch Resttumorgewebe kann mit hoher Wahrscheinlichkeit detektiert und damit die Tumorgrenze präziser erkannt werden. Das ist wesentlich, um etwa belastende Zweiteingriffe zu vermeiden.“ Durch den Einsatz der Technik würden zudem Personalressourcen geschont sowie die Sicherheit des Eingriffs gesteigert. „Der Einsatz derartiger Tools ist künftig zweifelsohne auch in anderen Disziplinen, in denen eine intraoperative Gewebeeinschätzung essenziell ist, denkbar“, so Neurochirurg Widhalm.
Die neue SRH-Technik ermöglicht dank KI eine raschere und bessere Entscheidung über die optimale chirurgische Strategie m Operationssaal.
SCHNELLER UND GENAUER.
Die SRH-Technik veranschaulicht einen der wichtigsten Motivatoren hinter der Anwendung von KI in der Medizin: Schnelligkeit. „KI kann komplexe Analyseschritte automatisieren und Medizin effizienter, vor allem aber effektiver für den Patienten gestalten, indem sie Krankheitsmuster erfassbar macht, um Therapieentscheidungen zu unterstützen“, bestätigt Georg Langs, Leiter des Computional Imaging Research Lab (CIR) an der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin der MedUni Wien und Chief Scientist sowie Co-Founder des Wiener Start-ups contextflow.
Contextflow, ein Spin-off der MedUni Wien, der TU Wien und des europäischen Forschungsprojekts KHRESMOI, entwickelt Algorithmen, die mithilfe von Deep-Learning-Modellen die Diagnose und Quantifizierung in radiologischen Bildern unterstützen. Die Software, die dabei in vielen europäischen Kliniken verwendet wird, analysiert CT-Aufnahmen und unterstützt Ärzte als Finalentscheider zum Beispiel bei der Früherkennung und Therapie von Krebs oder der Beurteilung von interstitiellen Lungenerkrankungen. Am Beispiel von contextflow wird ein weiterer Grund für den Einsatz von KI in der Medizin ersichtlich: die diagnostische Genauigkeit. „In der klinischen Praxis können Krankheitsmuster zwar beurteilt werden“, erklärt Langs, „aber die genaue Vermessung und Mitverfolgung ihrer Veränderung während des Krankheitsfortschritts ist realistisch nicht ohne Computerunterstützung möglich. Kein menschliches Gehirn hat die Kapazität, Hunderte Schnittbilder etwa der Lungeschnell miteinander zu vergleichen.“
Mittels KI als unterstützendes Tool sei es allerdings möglich, zum Beispiel die Ausmaße und auch die Heterogenität von Tumoren wesentlich genauer zu quantifizieren, wodurch die Diagnose und auch das Tracking – ebenso ein großer Motivator in der KI-Anwendung – erst zugänglich werden. „KI ist essenziell, wenn es darum geht, Krankheits- oder Therapieverläufe nachzuverfolgen“, erklärt Langs. Man könne damit nicht nur punktuelle, sondern vor allem longitudinale Beobachtungen anstellen, unterschiedliche Parameter zusammenführen und so eruieren, ob ein Patient
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ist essenziell, wenn es darum geht, Krankheitsoder Therapieverläufe nachzuverfolgen.
DIE TÜCKEN VON BIG DATA.
International wird aktuell intensiv am Einsatz von KI in der medizinischen Vorhersage geforscht. Im Kern – und ganz gemäß dem primären Versprechen der Präzisionsmedizin – geht es darum, die richtige Therapie zum richtigen Zeitpunkt dem richtigen Patienten zur Verfügung zu stellen. Hier setzt auch die MedUni einen Fokus in der Forschung. Um Vorhersagen zu ermöglichen, brauche es dabei aber, so Langs, große Patientenkohorten und Big Data, anhand derer Algorithmen lernen können. Denn in der Methodenentwicklung sei noch viel zu tun. Transparenz in den Validierungsergebnissen sei dabei eines der derzeitigen „Hot Topics“.
Langs erläutert: „Um etwa dem Bias entgegenzuwirken, dass bestimmte Modell aufgrund der Selektion der Trainingsdaten nur für Menschen eines Teils der Population einen Vorteil haben, braucht es vor allem Transparenz in der Beschreibung der Daten. Welche Daten wurden verwendet? Wie sah die Patientenkohorte aus? Wie wurden die Patientinnen und Patienten rekrutiert? Und können die verwendeten Daten die Diversität in der ‚echten‘ Bevölkerung adäquat wiedergeben?“
Große internationale Kooperationen auf EU-Level – Österreich wirkt mit mehreren Institutionen, darunter die MedUni Wien, im europäischen Leuchtturm- Projekt EUCAIM mit – sind wesentlich, um gemeinsam zu validieren, was gut oder weniger gut funktioniert, und damit auch die Weiterentwicklung der Modelle zu ermöglichen. Christian Maté, Arzt für Allgemeinmedizin und Experte im Bereich digitale Medien und Einsatz von KI im Gesundheitsbereich, ergänzt: „KI funktioniert umso besser, je mehr Daten zur Verfügung stehen. Datenschutz ist in diesem Kontext natürlich ein heikles Thema. Mittlerweile gibt es dafür aber unterschiedlichste technisch ausgeklügelte Lösungsansätze.“
Einer davon ist das sogenannte föderale Lernen, eine Technik des maschinellen Lernens, bei der ein Algorithmus nicht nur an einer zentralen Stelle, sondern an mehreren Stellen trainiert wird. Maté erklärt: „Im Zuge dieser Technik installiert man kleine Algorithmen an Endgeräten wie etwa Smartphones. Die Algorithmen trainieren am Smartphone mit lokalen Daten und werden anschließend als ‚frisch eingelernte‘ Algorithmen mit einer zentralen KI verknüpft – und zwar ohne sensible Daten weiterzugeben.“
Ebenso wesentlich sei es, dass sich maschinelles Lernen nicht in einer Blackbox abspielt, die KI also Dinge herausfindet, die zwar richtig, aber für den menschlichen Anwender nicht nachvollziehbar sind. „Noch vor einiger Zeit war das ein großes Thema, mittlerweile gelingt es, die KI dazu bringen, sich quasi in die Karten schauen zu lassen. Man spricht dann von ‚erklärbarer künstlicher Intelligenz‘“, erläutert Maté. Denn insbesondere in der Medizin sei es entscheidend, Ergebnisse, die eine KI liefert, auf Plausibilität überprüfen zu können.
Wir Menschen müssen in der Auseinandersetzung mit KI herausfinden, was uns jenseits kognitiver Leistungsfähigkeit ausmacht, was etwa der Mehrwert eines menschlichen Arztes im Vergleich zum superintelligenten Cyberdoktor ist.“


