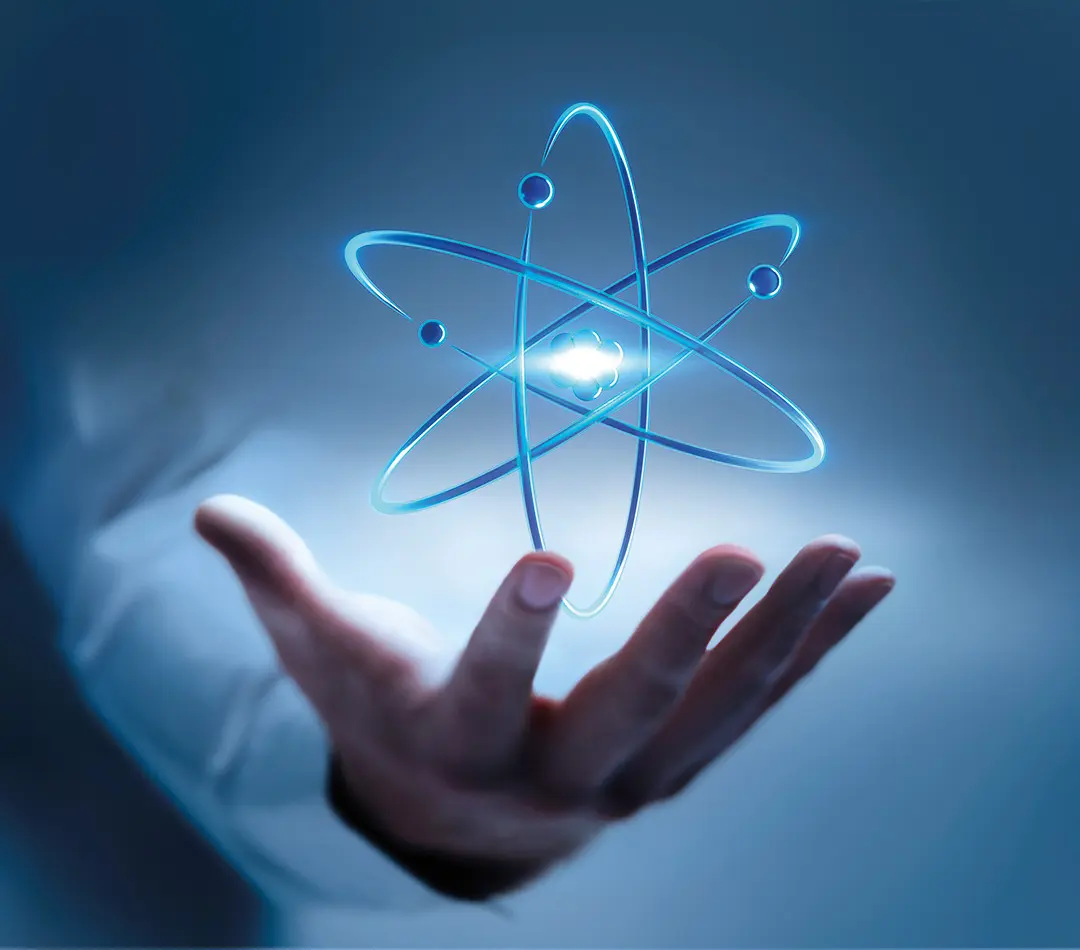
Es gibt noch gute Nachrichten: Bei der zukunftsweisenden Quantentechnologie gehört Österreich weltweit zur Spitze. Damit das so bleibt, braucht es weitere Förderprogramme, wie sie die Österreichische ForschungsförderungsGesellschaft FFG anbietet.
Er hat es getan – und bis heute nicht bereut. Vor drei Jahren hat der Physiker Rupert Ursin seine langjährige Tätigkeit am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Akademie der Wissenschaften aufgegeben und das Start-up Quantum Industries gegründet. Das klingt ein bisschen nach James Bond – und hat tatsächlich mit Hightech zu tun: Sein Unternehmen beschäftigt sich mit angewandter Quantentechnologie, speziell mit Hochsicherheit-Cybersecurity.
Quantentechnologie, das bedeutet superschnelle Computer, Megarechenleistungen, neue Dimensionen für Sensorik und Simulation komplexer, auch biologischer Systeme. Aber es bedeutet auch Gefahr. Denn immer leistungsfähigere Rechner beinhalten auch das Potenzial, bisher sichere Verschlüsselungstechniken in Sekundenschnelle knacken zu können. Deshalb müssen Banken, Versicherungen und Unternehmen, die kritische Infrastrukturen darstellen, in den kommenden Jahren „hurtigst sicherstellen, dass sie auch in einer Welt mit Quantencomputern“ weiter ausfallsicher operieren können, so Ursin. Quantum Industries’ Rezept dafür ist eine kryptografische Methode, die dazu beiträgt, dass die Infrastruktur abhörsicher und intakt bleibt.
Damit auch andere Ursins Weg vom Wissenschaftler zum Gründer gehen, hat die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG die Ausschreibung „Quantum to Market“ gestartet – passend zum von den Vereinten Nationen erklärten Internationalen Jahr der Quantenwissenschaft und -technologie. Gemeinsam mit dem Austria Wirtschaftsservice (aws) werden jeweils vier Millionen Euro vergeben, um die industrielle Umsetzung und wirtschaftliche Nutzung von Quantentechnologien, speziell Quantensensorik und Quantenmetrologie, zu unterstützen.


Quanten-Power. Sie pushen als starkes Quartett das Zukunftsfeld Quantentechnologie: Rupert Ursin (CEO Quantum Industries), Henrietta Egerth (Geschäftsführerin FFG), Christof Gattringer (Präsident FWF) und Gregor Weihs, Exzellenzcluster „Quantum Science Austria“ (v. l.).
© Gerald KuehrerZukunftstechnologie.
„Die Zukunft der Kommunikation und digitalen Sicherheit liegt in der Quantenwelt – und Österreich spielt dabei eine führende Rolle“, betont FFG-Geschäftsführerin Henrietta Egerth, „damit dies nicht nur für die Grundlagenforschung so bleibt, sind Anstrengungen erforderlich, um die klügsten Köpfe an Österreich zu binden und die Kommerzialisierung voranzutreiben“.
Österreich und die Quantentechnologie – das ist kein Zufallsmatch. Heimische Forscher:innen gehören im Ranking der meistzitierten Wissenschaftler im Bereich Quantentechnologien nach China, den USA, Deutschland und Großbritannien zu den Top Five. „Wenn man heute als Quantenforscher aus Österreich im Ausland ist, weiß die ganze Welt, dass wir in diesem Feld super sind“, unterstreicht das der Quantenphysiker Gregor Weihs, Leiter des Exzellenzclusters „Quantum Science Austria” an der Universität Innsbruck.
Auch die FFG, die als nationale Förderagentur im Auftrag des Innovationsministeriums (BMIMI) und des Wirtschaftsministeriums (BMWET) als Motor für Forschung und Entwicklung wirkt, hat das Potenzial des Themas für Österreich frühzeitig erkannt. In den vergangenen zehn Jahren hat die FFG insgesamt 124 Projekte mit einer Fördersumme von 170 Millionen Euro unterstützt.
Bereits 2021 ist die aus Mitteln des Europäischen Wiederaufbau- und Resilienzfonds (RRF) finanzierte Initiative „Quantum Austria“ des Bildungs- und Forschungsministerium gestartet. Gemeinsam mit dem Wissenschaftsfonds FWF vergibt die FFG bis 2026 rund 100 Millionen Euro. Für Egerth ist diese Zusammenarbeit „ein klares Zeichen, dass Forschung bei Grundlagenforschung beginnt und bei der Anwendung nicht aufhört, sondern ein sich immer wieder erneuernder Kreislauf ist“. Entscheidend sei, dass aus diesen Ergebnisse auch Produkte und Dienstleistungen für den Markt entstünden.
Jüngster Erfolg der heimischen Quanten-Community: Vor wenigen Monaten hat Thorsten Schumm von der TU Wien den Beweis der Machbarkeit einer Thorium-Atomkernuhr erbracht. Diese Entdeckung kann nicht nur die Zeitmessung des bisherigen Standards der Atomuhren revolutionieren, sondern auch die Genauigkeit von GPS-Systemen.


Branchen-Stars. Das von Wolfgang Lechner und Magdalena Hauser gegründete Unternehmen ParityQC gehört zu den wirtschaftlich erfolgreichsten der Quantenbranche.
© Parity QCVom Labor auf den Markt.
Ein Paradebeispiel für den erfolgreichen Weg von Forschungsergebnissen zu einem erfolgreichen Produkt ist das Unternehmen ParityQC von Wolfgang Lechner und Magdalena Hauser. Anfang 2020 als Spin-off der Universität Innsbruck und der Österreichischen Akademie der Wissenschaft gegründet verdient das Unternehmen mittlerweile Geld. Kaum etwas ist am Markt derzeit gefragter als Entwicklung und Bau von Quantencomputern – und genau darauf haben sich die Tiroler spezialisiert. ParityQC hat eine einzigartige Architektur entwickelt, die sich dadurch auszeichnet, dass sie unabhängig von der jeweiligen Hardwareplattform verwendet werden kann.
„Wir sind weltweit das einzige Unternehmen für Quantenarchitektur“, erklärt Wolfgang Lechner den Erfolg. Das Prinzip dahinter: Ähnlich der britischen ARM Holding, die Baupläne für Mikrochips entwickelt und diese in Lizenz verkauft, aber nicht selber herstellt, hat ParityQC dieses Modell auf Quantencomputer übertragen. Der japanische IT-Konzern NEC, mit dem ParityQC seit 2021 kooperiert, hat bereits den ersten Quantenprozessor auf Basis der ParityQC-Architektur vorgestellt.
Unterwegs Richtung Wirtschaft ist auch das Start-up Quantum Network Design. Die dahinter stehende Idee entstand aus den wissenschaftlichen Arbeiten zu Quantennetzwerken von Professor Wolfgang Dür und Alexander Pirker an der Universität Innsbruck.
Deren zentrale Fragestellung: Wie lässt sich ein Quantennetzwerk effizient planen und betreiben? „In der klassischen Informationstechnologie gibt es bereits leistungsstarke Simulationswerkzeuge für Computernetzwerke“, erläutert Alexander Pirker, „für Quantennetzwerke fehlt ein solches kommerzielle Pendant bisher – genau hier setzt unsere Technologie an.“ Bisher gibt es kaum kommerzielle Anbieter, die ein vollständiges Simulationswerkzeug für Quantennetzwerke bereitstelle, was die Entwicklung von Quantum Network Design so spannend macht.
Das Herzstück des Start-ups ist ein hochentwickelter Quantennetzwerksimulator. Dieser ermöglicht es, die komplexen Vorgänge eines solchen Netzwerks – also die Übertragung und Verarbeitung von Quanteninformationen – im Detail zu modellieren und zu analysieren. Das Ziel des Start ups: die Planung und Optimierung von Quanten-Netzwerken so realistisch wie möglich zu gestalten, noch bevor die physische Infrastruktur aufgebaut wird.


Netzwerk-Simulant. Alexander Pirker, Mitbegründer von Quantum Network Design, bringt Software-Erfahrung mit ein.
© BeigestelltRichtiger Gründer-Mix.
Doch von den Grunderkenntnissen der Forschung zur marktfähigen Anwendung ist es kein einfacher Weg. Bei Quantum Network Design half der richtige Mix der Gründer: Während Dür als einer der Pioniere im Bereich der Quantenkommunikation gilt, bringt Pirker auch umfassende Erfahrung aus der Softwareentwicklung mit – eine perfekte Kombination, um die Brücke von wissenschaftlicher Theorie zu praktischer Anwendung zu schlagen.


Setzen auf Sicherheit. Die QUBO-Gründer Philip Walther, Stefan Fürsinn und Borivoje Dakic (v. l.) transferieren Grundlagenforschung in eine Sicherheitslösung, speziell für Finanztransaktionen. Ihr Prinzip: die Bedrohung durch Quantencomputer mit Quantencomputern bekämpfen.
© BeigestelltQuanten-Token.
Auf ein anderes Zukunftsthema setzt das Wiener Start-up QUBO: die Sicherheit digitaler Kommunikation. Auf hier bildet österreichische Spitzenforschung die Basis: Professor Philip Walther, gemeinsam mit Professor Borivoje Dakic und Stefan Fürnsinn QUBO-Gründer, betreibt an der Universität Wien nicht nur Grundlagenforschung im Bereich Quantenphysik und -technologie, sondern auch die Entwicklung anwendungsnaher Lösungen. Die Vision von QUBO ist es, das Problem der Bedrohung durch Quantencomputer mit derselben Technologie zu lösen. „Man muss die Kraft von Quantencomputing mit Quantentechnologie selbst bekämpfen“, erklärt Walther. Genau hier setzt das Start-up an: die Entwicklung eines auf Quantenmechanik basierenden Tokens, der in Form von einzelnen Lichtteilchen genutzt werden kann, um die Sicherheit von digitalen Transaktionen zu erhöhen. Für ein großes österreichisches Finanzinstitut wurde bereits ein Quantenprotokoll entwickelt, das sowohl die Verbindung als auch die Endknoten verschlüsselt, um eine „absolute Absicherung“ von digitalen Zahlungen zu gewährleisten.
Unterstützt wurde das Gründer-Trio durch Fördermittel der FFG. „Das war notwendig, um den Schritt von der akademischen Forschung in die Wirtschaft zu schaffen“, betont Walther, „ein Schritt, der im Deeptech-Bereich oft besonders herausfordernd ist.“
Der FFG-Schwerpunkt im Bereich Quantentechnologie ist vielversprechend. Der Consulter McKinsey schätzt das weltweite Wertschöpfungspotenzial für die nächsten zehn Jahre auf bis zu 2.000 Milliarden US-Dollar. Begründung: Der vermehrte Einsatz von KI und komplexere Sprachmodelle benötigen immer mehr Rechenleistung, die nur Quantencomputer leisten können.
Quantentechnologien: Chance oder Bedrohung?
Um die Kraft der Quantentechnologie und die Perspektiven dieser neuen disruptiven Entwicklung für Österreich und Europa geht es bei einer Veranstaltung der FFG mit Expert:innen aus Wissenschaft und Wirtschaft. Passend zum World Quantum Day 2025 diskutieren u. a. Rupert Ursin (CEO Quantum Industries), Christoph Merte (Head of Innovation Erste Digital), Martin Stierle (AIT Austrian Institute of Technology) und Philip Walther (Universität Wien) über eines der vielversprechendsten Innovationsfelder unserer Zeit.
Die Veranstaltung findet am 14. April von 16.30 bis 20 Uhr in der Labstelle, Wollzeile 1, 1010 Wien statt. Anmeldungen unter www.ffg.at/event/ffgquantenperspektiven
„Wollen die Führende Rolle Österreichs weiter stärken“
Jetzt nicht nachlassen: die FFG-Chefinnen Henrietta Egerth und Karin Tausz über das große Potenzial der Quantentechnologie.


Henrietta Egerth (li.) und Karin Tausz (re.)
© FFG/Susanne EinzenbergerTREND: Welche Rolle wird Quantentechnologie in Zukunft spielen?
Henrietta Egerth: Die Zukunft der Kommunikation und digitalen Sicherheit liegt in der Quantenwelt. Unterstützt wird diese durch die rasante Entwicklung von KI, denn KI und Quantentechnologien werden früher oder später zusammenwachsen. Und was besonders erfreulich ist: Österreich spielt dabei eine führende Rolle. Damit dies nicht nur für die Grundlagenforschung so bleibt, sind Anstrengungen erforderlich, um die klügsten Köpfe an Österreich zu binden und die Kommerzialisierung voranzutreiben.
Welche Rolle kann die FFG dabei spielen?
Karin Tausz: Die FFG fungiert als zentrale Innovationsdrehscheibe für Österreich. Wir verknüpfen Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen und unterstützen Forscherinnen und Forscher bei der Weiterentwicklung ihrer Projekte nicht nur mit finanziellen Mitteln, sondern auch durch Förderung von Kooperationen. Diese Rolle übernehmen wir auch für die Quantenforschung als Schlüsseltechnologie der Zukunft.
Egerth: Wir haben die Bedeutung der Quantentechnologie schon vor vielen Jahren erkannt und als Förderschwerpunkt definiert. Auch weil Österreich auf diesem Gebiet internationale zur absoluten Spitze zählt. Seit 2014 hat die FFG Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 170 Millionen Euro unterstützt. Alles Investitionen in die Zukunft.
Die UN haben das Jahr 2025 zum Internationalen Jahr der Quantenwissenschaft und -technologie ausgerufen. Welche Bedeutung hat das?
Tausz: Anlass dafür ist die Formulierung der Quantenmechanik vor hundert Jahren. Mit dieser einjährigen, weltweiten Initiative sollen die bahnbrechenden Beiträge der Quantenwissenschaft zum technologischen Fortschritt der vergangenen 100 Jahre gewürdigt werden. Insgesamt beteiligen sich 57 Länder an diesem bedeutenden Jahr, das gleichzeitig die international verbindende Wirkung der Wissenschaft betont.
Egerth: Für die Umsetzung in Österreich spielt die FFG eine federführende Rolle, wir fungieren ja auch als „Nationale Kontaktstelle“ für EU-Programme. Bereits seit 2021 gibt es die aus Mitteln des Europäischen Wiederaufbau- und Resilienzfonds finanzierte Initiative „Quantum Austria“ des Bildungs- und Forschungsministerium. Gemeinsam mit dem Wissenschaftsfonds FWF vergibt die FFG bis 2026 rund 100 Millionen Euro. Diese Zusammenarbeit ist ein klares Zeichen, dass Forschung bei Grundlagenforschung beginnt und bei der Anwendung nicht aufhört, sondern ein sich immer wieder erneuernder Kreislauf ist.
Tausz: Zusätzlich knüpfen wir mit dem neuen Programm „Quantum to Market“ an Quantum Austria an. Der Fokus liegt dabei konkret bei der industriellen Umsetzung und wirtschaftlichen Nutzung von Quantentechnologien, speziell Quantensensorik und Quantenmetrologie. Gemeinsam mit dem aws stehen dafür insgesamt vier Millionen Euro pro Agentur zur Verfügung.
Wird angesichts des Budgetlochs nicht auch bei der Forschungsförderung gespart werden müssen?
Egerth: Gerade bei der Entwicklung von Quantentechnologien zeigt sich die nachhaltige Wirkung investierter Fördermittel. Österreichs Forschende und Unternehmen zählen hier zur Weltspitze – ein Vorteil, von dem der Standort auch in Zukunft profitieren wird. Umso wichtiger ist es, diesen Bereich weiter auszubauen und die Dynamik beizubehalten.
Tausz: Die Förderung von Forschung und Entwicklung, ohne die es keine Innovationen geben kann, ist eine wichtige Investition in den Wirtschaftsstandort. Und in die Zukunft.
Zu den Personen.
Henrietta Egerth ist nach Stationen in Brüssel, in der IV und im Wirtschaftsministerium seit 2004 Geschäftsführerin der FFG.
Karin Tausz ist seit September 2023 Mitglied der FFG-Geschäftsführung. Davor war sie als Managerin und Innovatorin in der Stadt- und Regionalentwicklung sowie im Mobilitätssektor in Forschungs-, Industrie- und Bahnunternehmen tätig.