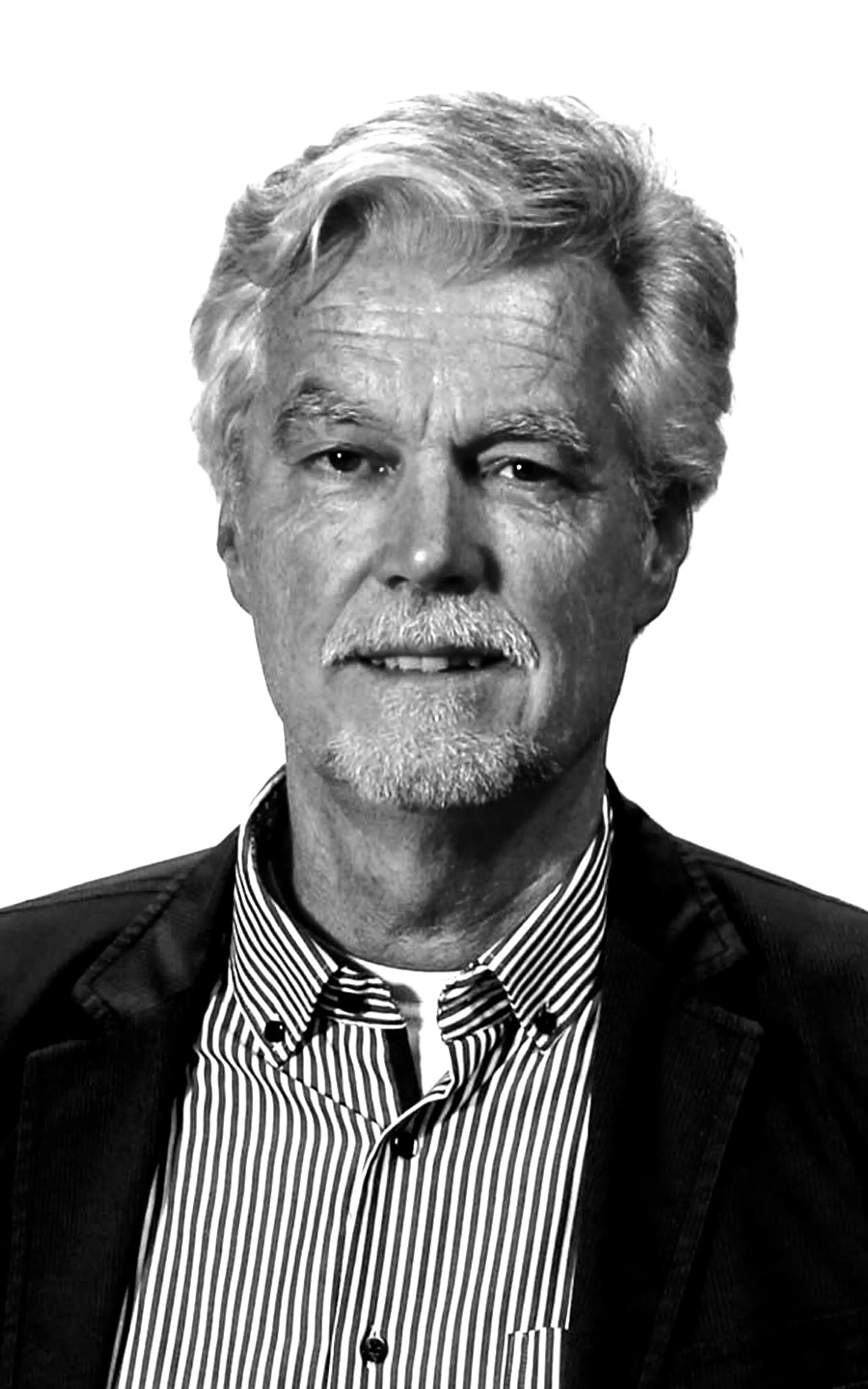Noch nie hat sich der Frust über die Bürokratie so laut und massiv entladen wie jetzt. Aber was konkret stört Unternehmer:innen am meisten, was gehört dringend abgeschafft? Oder brauchen wir überhaupt ein neues Verhältnis des Staates zu seinen Bürger:innen?
Mit Strom aus sauberer Wasserkraft das eigene Werk versorgen – wer will das nicht. Der Unternehmer Martin Christian Braun, Chef der gleichnamigen Vöcklabrucker Maschinenfabrik, wollte genau das und ging das Projekt engagiert an. Doch bevor der Strom tatsächlich aus der Ager kommen konnte, floss noch viel Wasser den Fluss hinunter: Zehn Jahr nach Beginn der Planung konnte das Ein-Megawatt-Kraftwerk schließlich realisiert werden. „Mein Vater war Idealist und hat das durchgezogen“, sagt Lennart Braun, der das Familienunternehmen mittlerweile in siebenter Generation leitet, „aber jeder rational kalkulierende Investor hätte das wegen der langen Verfahrensdauer längst aufgeben müssen.“
ESRS, CSRD, ARA, ERA, POP, CMRT, EMRT, RoHS – was wie ein Geheimcode oder ein Kreuzworträtsel für Hochbegabte klingt, sind Abkürzungen für verschiedenste nationale und internationale Umweltrichtlinien. Das Wiener Elektronikunternehmen Tele Haase, Hersteller von Steuerungs- und Messtechnik, fällt gleich unter sieben dieser Richtlinien. „Diese überbordende Regulatorik in Verbindung mit den ausufernden Berichtspflichten quält uns am meisten“, sagt CEO Marcus Ramsauer.
Zu viele Vorschriften, zu viel Papierkram, zu viele Hemmnisse – der Ärger über die alltägliche Bürokratie ist groß und laut wie nie. Obwohl erst April, hat „Bürokratieabbau“ gute Chancen, das Wort des Jahres zu werden. Die Politik sowohl in Brüssel als auch in Wien hat bereits reagiert und erste Erleichterungen und Vereinfachungen angekündigt. Mit dem Neos-Politiker Sepp Schellhorn wurde erstmals in Österreich ein eigener Staatssekretär für Deregulierung installiert. Dessen Job-Description: Hürden abbauen und wirtschaftliche Chancen stärken.
Frust über zu viel Staat
Doch allein die Einrichtung eines Staatssekretariats und einige kosmetische Korrekturen werden die Bürokratie-Diskussion kaum beruhigen. Das Thema hat eine enorme Eigendynamik entwickelt, auch weil es auf ein verbreitetes Gefühlt trifft, dass überall „zu viel Staat“ drinnen ist. Zu hohe und zu komplizierte Steuern, immer mehr Formulare, für gefühlt alles ist ein Antrag oder eine Genehmigung notwendig, viel zu langes Warten auf Behördenentscheidungen, Dokumentationspflichten für jedes Detail – das alles entlädt sich im Frustwort „Bürokratie“.
Unbestritten ist, dass die Vorschriften und Richtlinien in den vergangenen Jahren überproportional zugenommen haben. Allein die EU-Beamten erlassen jährlich 2.000 Rechtsakte – alles Regelungen, die irgendjemanden betreffen und beschäftigen. Und die in der Regel erhebliche Kosten verursachen. Nach Berechnungen des Münchner ifo-Wirtschaftsforschungsinstituts reduziert die Bürokratie die deutsche Wirtschaftsleistung um jährlich 146 Milliarden Euro. Nimmt man die grobe Relation von eins zu zehn, würde das für Österreich über 14 Milliarden Euro bedeuten – ein gewaltiges Konjunkturpaket, wenn man es denn nutzen könnte.
Die 14 Milliarden Euro dürften eher die Untergrenze markieren. In einer Studie für die Wirtschaftskammer hat die KMU Forschung errechnet, dass sich der Bürokratieaufwand allein für die heimischen Gewerbe- und Handwerksbetriebe auf jährlich 4,3 Milliarden Euro summiert. Rund 70 Millionen Arbeitsstunden müssen demnach aufgewendet werden, um alle notwendigen Genehmigungen einzuholen, die Einhaltung von Auflagen zu dokumentieren und Berichtspflichten zu erfüllen. Rein rechnerisch sind damit 42.000 Mitarbeitende beschäftigt, weitgehend unproduktiv.
Also am besten alles wegschneiden mit Kettensäge, Heckenschere oder Rasenmäher? Mit ganz so groben Werkzeugen wird Staatssekretär Schellhorn kaum zu Werke gehen können. Denn beim nächsten öffentlichen Fall von Subventionsbetrug oder Sozialstaatsmissbrauch wird der Aufschrei groß sein, warum die Behörden nicht stärker und genauer kontrolliert haben.
„Seit 50 Jahren versprechen Regierungen überall auf der Welt, Überregulierung einzudämmen, nur um dann festzustellen, dass das viel komplizierter ist, als es scheint“, kommentiert die Ökonomin Diane Coyle in einem Beitrag für den „Standard“ das Dilemma. Begründung: „Es gibt Vorschriften, welche die Unsicherheit verringern und ein effizientes Funktionieren der Märkte ermöglichen, etwa Standards im Bereich der Lebensmittelhygiene, der Schutz des Urheberrechts und die Wettbewerbspolitik. Ohne diese Vorschriften gerät Innovation ins Stocken und das Wirtschaftssystem leidet.“
Die meisten Unternehmer:innen betrachten das Thema denn auch durchaus differenziert. „Entbürokratisierung darf nicht heißen, dass dann jeder machen kann, was er will“, sagt auch Lennart Braun, „man muss nur im Einzelfall fragen, ob die getroffenen Maßnahmen auch das eigentliche Ziel erreichen.“
Problematisch sieht er zum Beispiel den Schutz älterer Arbeitnehmer. Das sei grundsätzlich sinnvoll, sagt Braun, aber die Auflagen seien so restriktiv, dass Unternehmen bei der Einstellung Älterer sehr zurückhaltend seien, vorsichtig ausgedrückt: „Der Schutz älterer Arbeitnehmer verkehrt sich ins Gegenteil, sie bekommen erst gar keinen Job.“
Viel Aufwand, wenig Nutzen
Worüber viele Wirtschaftstreibende klagen: Immer öfter entwickeln sich Aufwand und Nutzen in entgegengesetzte Richtungen. Ramsauer und sein Team müssen unter anderem den CO2-Fußabruck von Zink, Wolfram und Gold für die Widerstände in Leiterplatten errechnen sowie die damit verbunden Treibhausgase. Auch für den Bezug der Bauteile muss ein CO2-Nachweis erbracht werden. Das Problem: Der Großhändler, über den Tele Haase diese Teile bezieht, kauft selber weltweit bei 17 verschiedenen Fabriken ein. „Bei den 600 Elektronikprodukten, die wir anbieten, sind übers Jahr gesehen 1,5 Vollzeitbeschäftigte nur mit Recherche und Ausfüllen der Berichte beschäftigt“, hat Ramsauer errechnet, „das sind Kosten von rund 80.000 Euro pro Jahr – unproduktive Euro.“ Umweltschutz sei wichtig, betont Ramsauer, „aber ob diese Detailliertheit wirklich notwendig ist“?
Das fragt sich auch Spitzenkoch Mike Nährer, der als Gastronom mit einer Vielzahl an Aufzeichnungen und Nachweisen in den Bereichen Lebensmittelhygiene, Arbeitssicherheit, mit Vorschriften und Vorgaben bei Steuern und Betriebsanlagen konfrontiert ist. „Leider erschließt sich mir der Mehrwert dieser Maßnahmen nicht immer“, so sein trockener Kommentar. Nährer führt den Familiengasthof im niederösterreichischen Rassing in dritter Generation und hat ihm ein modernes Konzept mit Fokus auf lokale Produkte verpasst. Das Gasthaus bietet Platz für 80 Gäste. „24 Notausgangsleuchten waren nötig – bei insgesamt viel Glas und nur vier Türen, die nach außen führen“, berichtet Nährer kopfschüttelnd. Dazu kommt: Bei mehr als 20 Sicherheitsleuchten in einem zusammenhängenden Gebäudeteil ist zusätzlich eine automatische Prüfeinrichtung mit zentraler Erfassung vorzusehen.
Als weiterer Kostentreiber stellt sich oft die Bauordnung heraus. Sie sieht zum Beispiel für Nährers Gasthaus eine umfangreiche Unterfangung vor, also die Sicherung des Gebäudes gegen Abrutschen bei Erdarbeiten unterhalb der Fundamente. Sie ist auf das Drei- bis Fünffache der nötigen Statik ausgelegt, klagt Nährer, was mit entsprechenden Kosten verbunden ist. „Ich stelle nicht in Abrede, dass es viele sinnvolle Vorschriften gibt, aber sie sollten situationsadäquater gehandhabt werden“, so der Gastronom, der zwölf Mitarbeitende beschäftigt. Ein Negativbeispiel ist für ihn auch die Verpflichtung, mit regelmäßiger Frequenz „weitgehend selbsterklärende“ Hygiene- und Gefahrenunterweisungen samt Dokumentationspflicht durchzuführen – und das auch bei langjährigen Mitarbeitern.
Mike Nährer ist kein Einzelfall, Rassing ist überall. Bürokratie in der Gastronomie sei keine einzelne Hürde, die einfach zu überwinden sei, sondern ein Netz aus zahllosen Vorschriften, lautet der Befund der Wirtschaftskammer Steiermark. Die bürokratischen Verpflichtungen würden fast zehn Prozent der Personalkapazitäten im Gastronomiebereich binden, so das Ergebnis der Kammer-Analyse.
Arbeitszeitaufzeichnungen, die Modalitäten für Förderungen oder Meldepflichten für die Statistik Austria sind einige der Dinge, die auch Barbara Frühwald, Geschäftsführerin von Taxi mit Herz mit Standort Sankt Pölten, Frust bereiten. Sie ärgert sich, dass sie für das Einreichen einer Förderung, beispielsweise im Bereich Digitalisierung, auf die Beratungsleistung Dritter angewiesen ist. Sie verbringe viel zu viel Zeit damit, die Arbeits- und Pausenaufzeichnungen ihrer 20 Fahrer:innen ins elektronische System zu übertragen oder die Daten für die Leistungs- und Strukturerhebung (LSE) der Statistik Austria zusammenzutragen, klagt die Unternehmerin.
Zu viel doppelt
Ein permanentes Ärgernis sind die vielen Doppelgleisigkeiten. Beispiel ausländische Fachkräfte, eine Dauerbaustelle der heimischen
Wirtschaft. „Wir sind in einem Bereich tätig, wo wir in Österreich so gut wie keine geeigneten Fachkräfte finden“, berichtet Hubert Walker, Senior Manager von vysion consulting, einem SAPBerater mit 45 Mitarbeitenden in Wien, Innsbruck und Graz sowie einer Tochtergesellschaft in Deutschland.
Für die Rekrutierung aus Drittstaaten setzt Walker auf die Rot-Weiß-Rot-Karte. Doch ob und wann diese ausgestellt wird, ist völlig ungewiss. „Ich verstehe, dass eine Prüfung notwendig ist, doch sie dauert viel zu lange und ist wenig transparent“, klagt Walker. Vor allem die zeitliche Ungewissheit ist problematisch: „Wir machen ausschließlich Projektarbeit, aber wie soll ich planen, ohne zu wissen, ob und wann ein Mitarbeiter zur Verfügung steht?“ Zusätzliche Hürde: Ohne Arbeitsvertrag finden potenzielle Mitarbeitende keine Wohnung.
Was den Unternehmer besonders ärgert: „Kandidaten müssen in Österreich trotzdem extra ansuchen, obwohl sie eine Arbeitserlaubnis für Deutschland haben.“ Hier sei eine EU-weite einheitliche Regelung mehr als notwendig.
Mit ganz spezifischen Doppelgleisigkeiten zu kämpfen hat auch das Wiener Health-Tech-Unternehmen Biome Diagnostics. Die beiden Gründer Barbara Sladek und Nikolaus Gasche sind 2018 mit der Marke myBioma angetreten, um die Darmgesundheit zu verbessern. Mittels KI werden die Mikroorganismen sequenziert, die Bakterienarten sowie deren relative Häufigkeit können so detailliert im Mikrobiom identifiziert werden und geben Aufschluss über wichtige Gesundheitsparameter wie das Entzündungspotenzial. Was die Forscher bremst: Obwohl die personenbezogenen Daten nur anonymisiert verwendet werden, gibt es starke Einschränkungen durch die Datenschutz-Grundverordnung DSGVO.
Was das Biome-Duo noch härter trifft, ist das aufwendige Zulassungsverfahren für Medizinprodukte. „Qualität ist bei Medizinprodukten absolut notwendig“, sagt Barbara Sladek, „aber es gibt viele Doppelgleisigkeiten.“ So verfügt Biome über die ISO-Zertifizierungen 9001:2015 (Qualitätsmanagementsysteme) und ISO 13485:2016 (Medizinprodukte), fällt aber trotzdem unter die Medizinprodukteverordnung MDR, „obwohl die ISO-Zertifizierungen mindestens einen gleichwertigen Hebel bieten, um Qualität und Sicherheit auf höchstem Niveau zu gewährleisten“, kritisiert Sladek.
Neue Vertrauenskultur
Ob der bürokratische Ballast durch einzelne Streichungen zu verringern ist – Expert:innen zweifeln daran. In Deutschland hat sich daraus schon eine sehr viel grundsätzlichere Diskussion ergeben: Eine Kommission rund um den ehemaligen SPD-Finanzminister Peer Steinbrück und den Ex-Präsidenten des deutschen Verfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle fordert nichts weniger als einen neuen Umgang des Staates mit seinen Bürgern. „Wir müssen von einer Misstrauens- zu einer Vertrauenskultur kommen“, fordert Voßkuhle.
Konkret: Der Staat und seine Institutionen sollten von dem Grundsatz ausgehen, dass sich die meisten Bürger:innen und Unternehmer:innen an die Regeln halten, Pauschalregelungen könnten dann das Dickicht an unzähligen verschlungenen Einzelregelungen ersetzen. Statt umfangreichen Nachweispflichten für alle würde es nur Stichproben geben. Wer das Vertrauen missbraucht, müsste allerdings mit härteren Strafen rechnen als bisher. So verstanden wäre das Thema Bürokratieabbau kein technisches Unterfangen, sondern der Beginn eines neuen Mindsets.
Der Artikel ist im trend.KMU vom 28. März 2025 erschienen.